Sonntag, 7. Mai 2006 0:24
Warnung: Dies ist ein sehr langer Text, der einiges an Wissen über das Voynich-Manuskript voraussetzt.
0. Vorab
Es gibt einige Seiten im Manuskript, die auf besondere Weise ausgezeichnet zu sein scheinen. Das zeigt sich mir, der ich leider den »Text« nicht verstehen kann, vor allem an der graphischen Gestaltung der Seite, die deutlich vom Durchschnitt des Manuskriptes abweicht. Kann man den meisten Seiten ein grobes Thema zuordnen (Pflanzenkunde, Arznei- oder Drogenkunde, Astrologie, Kosmologie, Nymphenbadekunde [1] oder die abschließenden Textabsätze), das auch an anderen Stellen des Manuskriptes abgedeckt wird, so wirkt die Zuordnung bei diesen Seiten gezwungen; sie scheinen eher eine Klasse für sich zu bilden.
Diese Seiten sind:
- f49v (Die Blüte aus dem Gordischen Knoten)
- f57v (Das Schriftkarrusell oder Der Papiercomputer)
- f58r (Die Drei Sterne)
- f66r (Die Drei Spalten)
- f76r (Die Nummerierung)
- f81r (Das unsichtbare Bad)
- f86v5 (Die Neun Rosetten oder Die Schatzkarte)
- f86v3 (Die Vier Quellen der Welt)
Natürlich ist diese Auswahl etwas willkürlich. Sie listet Seiten auf, die sich nicht sicher einem der angenommenen Themen dieses Kompendiums zuordnen lassen. Dass die meisten dieser Seiten dem kosmologischen Komplex zugeordnet wurden, erscheint mir mit Ausnahme von f86v3 fragwürdig — ich sehe dort kein Konzept der Kosmologie. Ich hätte aber auch mit gutem Recht f86r2 in diese Sammlung aufnehmen können, obwohl dort eine Wirkung der Sonne (oder des im Bezug zur Sonne stehenden Goldes) das Thema zu sein scheint. Diese Seite unterscheidet sich dennoch deutlich von anderen kosmologischen Seiten wie f86v4. Dennoch zähle ich sie nicht zu dieser Sammlung, da sie einen klaren (vielleicht esoterischen) kosmologischen Bezug zur Sonne hat.
Meine kleine Sammlung von Seiten nenne ich die »Seltsamen Seiten« — jede dieser Seiten hat Eigenschaften, die völlig einmalig im Manuskript sind und die deshalb die Deutung schwierig machen. Bislang scheint diesen Besonderheiten nur im kryptologischen Zusammenhang Beachtung geschenkt worden zu sein, man erhoffte sich Aufschluss über den Zeichenvorrat. Diese Betrachtungen will ich nicht wiederholen, das können andere Menschen auch besser als ich. Stattdessen will ich jede dieser Seiten mit Ausnahme der Schatzkarte kurz würdigen und aufzeigen, wo sich dort Ansatzpunkte für tiefere Betrachtungen finden. Vor allem tue ich das, damit der Inhalt meines Notizbuches [2] auch anderen Interessierten von Nutzen wird.
Als Transkriptionsmethode in diesem ganzen Text wird EVA verwendet.
1. Die Blüte aus dem Gordischen Knoten f49v
1a. Besonderheiten
Man mag zunächst denken, dass es sich hier um eine normale pflanzenkundliche Seite handele. Das gesamte Layout sieht danach aus: eine große, seitenfüllend gezeichnete Pflanze ist von Text im Schriftsystem des Manuskriptes begleitet.
Wer mit dem Manuskript vertraut ist, stellt jedoch drei Besonderheiten fest, die diese Seite von allen pflanzenkundlichen Seiten unterscheidet:
- Der Text ist außerordentlich lang.
- Den insgesamt 26 Zeilen sind abgesetzte Glyphen zugeordnet, die oft den Eindruck machen, nur halb ausgeführt zu sein oder »verkrüppelte« Formen des normalen Glypenvorrates darzustellen. Es findet sich die obere Hälfte des »o« als isoliertes Zeichen; es findet sich ein »r«, das wie eine arabische Ziffer »2« geformt ist; es findet sich ein »s« mit einem deutlichen Knick, der an ein »r« erinnert; es findet sich eine einmaliges Zeichen, ein »i« mit einem Abwärtstrich wie ein »y«.
- Die Zeilen von 2 bis 6 in mit arabischen Ziffern von 1 bis 5 durchnummeriert, diese Ziffern sind in moderner Form geschrieben, nicht in mittelalterlicher. Es handelt sich also hochwahrscheinlich um eine spätere Hinzufügung. Da aber nicht auszuschließen ist, dass der Schreiber dieser Ziffern das Manuskript noch verstand, kann diese Hinzufügung einen wichtigen Fingerzeig geben.
1b. Fakten
- Currier-Sprache A, Handschrift 1
- Bestandteil des siebten Bündels
- Rückseite der ersten Seite im Bündel
1c. Anmerkungen
Wenn die Ziffern fast sicher eine spätere Hinzufügung sind, dann kann das natürlich auch für die abgesetzten Glyphen gelten. Der Aufbau dieser abgesetzten Glyphen zeigt jedoch, dass sich ihr Schreiber stark mit dem Aufbau des Schriftsystemes und seiner Konposition aus einzelnen Stichen beschäftigt hat. Dabei ist sogar eine Kombination entstanden, die nicht zum normalen Vorrat gehört — nämlich das i mit dem »y«-Abwärtstich. Die Verbindung mit einer Nummerierung könnte bedeuten, dass ein Zusammenhang zwischen der Komposition der Glyphen aus Einzelstrichen und der Abfolge der natürlichen Zahlen notiert werden sollte; sie könnte aber auch ein Verweis auf einen systematischen Aufbau des Schriftsystemes sein.
Selbst wenn dieser Teil eine spätere Hinzufügung ist, so fällt diese Seite durch ihren zu langen Text aus dem Rahmen pflanzenkundlicher Seiten im Manuskript.
Die Handschrift der arabischen Ziffern erinnert stark an die Seitennummerierungen im Manuskript.
1d. Mögliche Fragen
- Hat die Glyphenfolge dieser Seite (ohne die abgesetzten Zeilen) Eigenschaften, die für den pflanzenkundlichen Teil ungewöhnlich sind?
1e. Spekulationen
Das Auftreten einer solchen Seite in der Pflanzenkunde überrascht — ausgehend vom Thema der Pflanze scheint hier der Aufbau des Glyphensystemes behandelt zu werden. Steht die Pflanze in einem Zusammenhang zum Thema des Schreibens? Wird eine Komponente der Tinte, ein Farbstoff oder ein anderes Schreibmaterial daraus gewonnen? Sind die unteren Triebe am Stängel entfernt worden, um die Ausbeute dieser Substanz zu verbessern?
2. Das Schriftkarussel oder Der Papiercomputer f57v
2a. Besonderheiten
Diese Seite zeigt starke Anzeichen mehrfacher Restauration, in den hochauflösenden Bildern sieht man gelegentlich drei Schichten Tinte. Einige Glyphen wurden bei diesen Restaurationen falsch oder verstümmelt wiederhergestellt, teilweise scheint eine Näherung an den ursprünglichen Glyphenbestand aus den hochauflösenden Bildern noch möglich. Diese offenbar schon fröhen Bemühungen um den Erhalt des Inhaltes dieser Seite zeigen, dass der Inhalt für sehr wichtig gehalten wurde. Das ist umso erstaunlicher, als dass die graphische Gestaltung zunächst keinen Hinweis auf das Thema der Seite gibt; ein Bezug zu kosmologischen Themen ist nicht erkennbar. Die Einordung dieser Seite unter die Kosmologie erscheint gekünstelt.
Wenn mich jemand fragen würde, welche Seite am eingehendsten unter besonderem Licht fotografiert werden sollte, so würde ich f57v nennen. Wie gleich deutlich werden wird, halte ich diese eine Seite für die wichtigste Seite des gesamten Manuskriptes.
Trotz des relativ schlechten Zustandes der Erhaltung und der missglückten Restaurationsversuche in längst vergangener Zeit ist immer noch ein ungewöhnlich stark strukturierter Aufbau vor allem der drei inneren Ringe mit Text zu erkennen. Dieser Text »fließt« nicht wie die Beschreibungen zu den Pflanzen oder die ringförmigen Texte zu den Himmelskörpern (siehe etwa f67r), sondern die einzelnen Glyphen und kurzen Glypenfolgen sind deutlich voneinander abgegrenzt und sollen ihre Position möglichst genau einnehmen. Einige Glyphen bekommen aus diesem Grund ein besonders »breites« Erscheinungsbild, etwa die stark verzierten, schwungvollen »f«- und »p«-Glyphen. Im Gegensatz dazu wirken die kurzen »Wörter« in den Ringen an einigen Stellen sehr »gedrängt«, als wenn sie in einen bestimmten Platz passen mussten. (Im zweiten Ring vor allem »shes« und »okchod«, im inneren Ring »otchody«) Angsichts der verfügbaren Platzes und des teilweise großen Abstandes zwischen einigen dieser Glyphenfolgen wäre eine solche Maßnahme bei freiem Schreiben nicht nötig gewesen.
Darüber hinaus verwirrt diese Seite mit mehreren Symbolen, die einmalig im gesamten Manuskript sind. Einige davon gehen sicherlich auf schlechte Restauration zurück, aber das glaube ich für die folgenden Weirdos (haben wir eigentlich einen ähnlich griffigen deutschen Begriff dafür) nicht:
- 1. Ring von innen, 12 Uhr: Ein eckiges Symbol mit einem darüber gezeichneten Punkt und einem Verbinder auf die linke Seite, das entfernt an ein eckiges »h« mit abgesetztem oberen Teil erinnert.
- 2. Ring von innen, ca. 8 Uhr: Ein Zeichen wie ein kopfstehendes griechisches Lambda.
- 3. Ring von innen, 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr: Eine Aufeinanderfolge zweier rechter Winkel, einer wie ein »L« stehend, der andere angefügt wie ein »^«. Über dem ersten Winkel befindet sich ein Kreis. Die Vermutung von Berj, dass es sich hierbei um den Symbolvorrat des freimaurerischen Codes handelt, kann ich nach oberflächlicher Beschäftigung unterstützen, es würde sich dann um die Zeichenfolge »LV« handeln (römische Schreibweise für 55). Das schon für den ersten Ring erwähnte eckige Symbol könnte wohl ähnlich interpretiert werden, aber das überlasse ich lieber Menschen, die sich besser mit der Freimaurerei und der dort auftretenden esoterischen Symbolik auskennen.
- Überall in den Ringen: Die vielen »v« und »x« halte ich für eine Absicht des ursprünglichen Autors.
Eine weitere Besonderheit dieser Seite ist der 3. Ring von innen, dessen Glyphenfolge viermal fast identisch wiederholt wird. Dabei wird ein betont großer Abstand der Glyphen sicher gestellt, hier fließt nichts zusammen.
Dass in dieser Wiederholung ein »p« für ein »f« stehen kann, zeigt, dass diese Glyphen in irgendeiner Weise verwandt sein könnten — diese Vermutung wird aber auch von der optischen Erscheinung der beiden Glyphen schon genährt. Für eine genauere Aussage müsste man an Hand der hochauflösenden Bilder untersuchen, ob die Lesung der Glyphen wirklich sicher ist — aus dem mir vorliegenden Bild würde ich im Moment gar nichts schließen wollen.
Unten links auf der Seite befindet sich ein schwer deutbares Symbol, das nicht zum Schriftsystem des Manuskriptes gehört.
Diese augenfälligen Besonderheiten brachten mich zur Bezeichnung »Schriftkarrussel«, die zweite Bezeichnung »Papiercomputer« werde ich unter den Spekulationen zu dieser Seite etwas erhellen.
2b. Fakten
- Currier-Sprache: B, Handschrift 2
- Bestandteil des achten Bündels
- Rückseite der ersten Seite des Bündels
2c. Anmerkungen
Dies ist die einzige kreisförmige Anordnung, in der der Autor den Mittelpunkt des Kreises deutlich hervorgehoben hat. Es handelt sich um einen klar sichtbaren Punkt, der zur Hervorhebung von einem kleinen, offenbar handgezeichneten Kreis umgeben ist. Zur zusätzlichen Hervorhebung wurde dieser Punkt von einer Rosette umgeben. Der Mittelpunkt dieser Anordnung muss also eine Bedeutung haben, wahrscheinlich steht diese Bedeutung in enger Beziehung zu der sehr streng wirkenden Anordnung der einzelnen Glyphen und kurzen Glyphenfolgen.
Außerhalb der Ringe befindet sich der Bezeichner »dairol«, als wäre dies der Name für eine derartige Anordnung. Dieses Wort ist selten im Manuskript. In der Transkription von Takeshi Takahashi wird es genau zweimal gelesen, nämlich hier und in f77v.P.21. Auf f77v lese ich allerdings ein anderes Wort, da hier der Aufwärtsbogen vom »r« in der Mitte des »i«-Striches angesetzt wird — leider wird diese Feinheit in EVA nicht unterschieden.
2d. Mögliche Fragen
- Wer die hochauflösenden Fotos und ausreichend Rechenleistung hat, sollte ruhig einmal versuchen, so viel von der Originaltinte des ursprünglichen Schreibers wie möglich sichtbar zu machen. Ich erwarte teilweise große Abweichungen vom jetzigen Stand. (Einige Wierdos werden sich als Fehler bei der Restauration entpuppen, und einige geschwungene »f«- und »p«-Glypen werden eventuell wichtige Details zeigen, die kaum noch sichtbar sind)
- Bei einer derartigen Bildbearbeitung sollte auch das spiralförmige oder »S«-förmige Symbol in der rechten unteren Ecke erforscht werden. Hat es die gleiche Farbe wie die verwendete Tinte des Originalautors, ist darunter eine Zeichnung sichtbar zu machen. Es wäre interessant, ob dieses Zeichen zum ursprünglichen Entwurf gehört oder eine spätere Hinzufügung ist.
- Auch das ursprüngliche Aussehen der Nymphen wäre interessant — die Frisuren sehen aus, als seien sie nachträglich gezeichnet worden.
2e. Spekulation
Augenfällig ist die 4×17-Sequenz, in den Kommentaren zur Stolfis Interlinear-Archiv ist die Seite nach dieser Zeichenfolge benannt. Da hierzu schon so viel geschrieben wurde (wenn auch in englischer Sprache), stürze ich mich auf ein Thema, das dabei bislang völlig ignoriert wurde — auf die Zahlen.
Die Vier oder die Acht sind recht häufige Zahlen im graphischen Aufbau des Manuskriptes, und diese Zahlen haben auch eine klare psychologische (Eso-Freunde lesen bitte: esoterische) Bedeutung, da sie einen Anklang an die Himmelsrichtungen, an die Ganzheit der Erde enthalten. Eine wichtige Illustration, »die Schatzkarte« f86v5, besteht aus acht Rosetten um eine zentrale Rosette, viele dieser Rosetten zeigen wieder vierzählige Symetrie oder eine Vierzahl von Elementen. Von daher überrascht das Auftauchen einer Vierheit auf dieser Seite nicht — aber die Siebzehn überrascht sehr wohl. Nun ist Siebzehn aber gerade 4*4+1, also etwas, was über die vierfache Vierheit, ein wirklich starkes Symbol des Alls hinausgeht, ein numerisches Zeichen des Überwindens unseres Weltgefüges. (Die Überschrift hier lautet Spekulation, nicht wahr.) Dieses Symbol könnte klar machen, dass das Schriftsystem des Manuskriptes die vertrauten Bezüge der Lebenswelt durchbricht — der Inhalt wird es dann ja um so mehr tun.
Aber jetzt einmal etwas weniger wild spekuliert: Was ist auf dieser Seite dargestellt?
Es handelt sich definitiv nicht um Kosmologie, auch wenn diese Seite in diese Kategorie eingeordnet wird. Und es gibt augenfällige Unterschiede auch zu den abstraktesten kosmologischen Seiten im Manuskript (nehmen wir mal f68v1 als Beispiel, damit ein Vergleich möglich ist):
- Die Schrift fließt nicht im Kreis, sondern ist ungewöhnlich präzise angeordnet.
- Es ist kein kosmisches Objekt, also keine Sonne, kein Stern, keine Erde dargestellt.
- Es fehlt dieser Seite generell an graphischer Darstellung, sieht man einmal vom hervorgehobenen Mittelpunkt und den vier Nymphen ab. Diese Seite ist die abstrakteste Illustration im Manuskript, als sollte hier ein nicht zeichnerisch darstellbares Thema vermittelt werden.
- In den vorgezeichneten Kreis wird kein Text transportiert, sondern das Schriftsystem analytisch (also zerlegend) behandelt und mit einem Glyphenvorrat aus einem anderen Schriftsystem kombiniert. (Vielleicht mit dem Code der Freimaurer.)
Aus diesen ganzen Informationen ergibt sich für mich ein möglicher Schluss: Es handelt sich um einen Papiercomputer. Es ist eine Zeichnung, die zu dem Zweck gemacht ist, dass man mit einem Hilfsmittel (etwa einem angelegten Lineal, vielleicht aber auch einem unregelmäßig geformten Gegenstand — das Zeichen in der rechten unteren Ecke gibt doch zu denken) Informationen ablesen kann. Da der Mittelpunkt hervorgehoben ist, muss er in diesen Vorgang eine Rolle spielen. Wenn ein Lineal angelegt wird, dann wird es gewiss durch diesen Mittelpunkt hindurch angelegt. Vermutlich gehörte eine Art Lineal mit Markierungen an bestimmten Stellen zu dieser Zeichnung, und vermutlich konnte man auf diese Weise Informationen über den Aufbau des Schriftsystemes (vielleicht sogar über seine Bedeutung) gewinnen.
Und wegen dieser Spekulation, die ich für gut begründet halte, halte ich die Seite f57v für die wichtigste Seite im gesamten Manuskript – vielleicht für den einzigen Schlüssel, den wir noch haben.
3. Die Drei Sterne f58r
3a. Besonderheiten
Es handelt sich um eine fast völlig normale Textseite, bestehend aus drei Absätzen, die jeweils durch einen Stern oder eine Blüte dekoriert wurden.
Was diese Seite besonders macht, ist der erste Absatz — hier wurden die ersten drei Zeilen eingerückt, offenbar, um einer Zeichnung, einem Symbol oder einer ausgeschmückten Glyphe Platz zu machen. Dieser Entwurf wurde jedoch nicht umgesetzt, und so bleibt dort eine auffällige leere Stelle.
3b. Fakten
- Currier-Sprache: A, Handschrift unbekannt
- Bestandteil des achten Bündels
- Vorderseite der zweiten Seite im Bündel
3c. Anmerkungen
Die Anzahlen der Zacken der Sterne mehren sich von oben nach unten. Der oberste ist sechszackig, der mittlere siebenzackig, der untere achtzackig. Der obere Stern hat in der Mitte einen einfachen Punkt, die beiden weiteren haben jeweils einen kleinen Kreis von der ungefähren Größe eines »o« in der Mitte.
3d. Mögliche Fragen
- Lässt sich mit Bildbearbeitung an der freie Stelle eine Spur von Vorzeichung des dort geplanten Objektes entdecken?
3e. Spekulation
Die meisten Menschen gehen davon aus, dass beim Schreiben des Manuskriptes zunächst die Zeichnungen angefertigt wurden; der Text wurde dann in einem zweiten Arbeitsgang geschrieben. Im speziellen Fall dieser einen, wahrscheinlich nicht vollständigen Seite, lässt sich dies widerlegen. Hier wurde erst geschrieben, und beim Schreiben wurde der Raum für die Zeichnung freigelassen.
Das ist insofern interessant, als dass die Zeile nach den Ergebnissen von Currier eine eigene Informationseinheit darstellt. Wären die Textzeilen dort entstanden, wo die Grafik ihnen Raum gelassen hat, so erschiene dies als völlig unlogisch. Wird jedoch die Grafik später in den Text eingefügt, so wäre eine solche Anordnung ohne weiteres denkbar. Der Augenschein kann bei diesem Manuskript ganz schön in die Irre führen.
Die beiden Textseiten f58r und f58v liegen übrigens zusammen mit den beiden pflanzenkundlichen Seiten f65r und f65v (die andere Seite des Bifolios) an einer unpassenden Stelle im Bündel. Sie könnten falsch gebunden sein und vom Autor in einen anderen Zusammenhang beabsichtigt sein.
4. Die Drei Spalten f66r
4a. Besonderheiten
Textseite mit großer Textmenge. Interessant ist hier die dreispaltige Gestaltung. Am linken Rand befindet sich eine Spalte, in der auf ungefähr zwei Textzeilen jeweils ein kurzes Wort der voynichianischen Sprache erscheint. Neben dieser Spalte befindet sich eine zweite Spalte, die Glyphen, Ligaturen und kurze Glyphenfolgen des Schriftsystems enthält. In der dritten Spalte ist der Text enthalten.
Unten befindet sich die Zeichnung einer liegenden Nymphe mit drei unidentifizierbaren Objekten. Dazu steht ein Text in lateinischen Buchstaben in einer schwerfälligen, ungeübten Kursive. Meine Lesung ist »v ?en mv? del« — manche lesen hier so etwas wie »u(nd) den Mussteil«, was ich für eine Überinterpretation halte. Sollte jedoch der voynichianische Text »otcheo daiin chty ykeescheg« irgendeinen Bezug zum lesbaren Text haben, dann lohnt sich vielleicht der Kopfschmerz mit seiner Deutung.
4b. Fakten
- Currier-Sprache: B, Handschrift unbekannt
- Bestandteil des achten Bündels
- Vorderseite der letzten Seite des Bündels
4c. Anmerkungen
Da über diese Anordnung jede Menge hervorragendes Material verfügbar ist, mache ich mir nicht die Mühe, selbst viel dazu zu schreiben. Wenn die dreispaltige Gestaltung in der Absicht des Autors lag (und keine spätere Hinzufügung ist), dann gibt diese Seite einen guten Einblick in den Zeichenvorrat des Schriftsystems.
5. Die Nummerierung f76r
5a. Besonderheiten
Eine Textseite mit großer Textmenge. Das erste Zeichen ist ein großer, in Umrisslinien gezeichneter Gallow, wohl ein »t« oder »p«. Aus der Ausführung der Zeichnung kann man auch ersehen, wie die Gallows wohl mit der Feder gezeichnet wurden. Zunächst wurde der linke senkrechte gezeichnet, dann der schwungvolle Bogen, der daraus den speziellen Gallow formte. Sowohl das Wiederansetzen der Feder als auch das Zeichnen über den anfänglichen Strich ist in der Verzierung deutlich ausgeführt. (Was man hier nicht sehen kann, aber an einigen normalen Stellen sehr gut, das ist, dass die Striche von oben nach unten geführt wurden.)
Auf der linken Seite des Textes stehen einzelne Glyphen oder Glyphenfragmente.
5b. Fakten
- Currier-Sprache: B, Handschrift 2
- Bestandteil des 13. Bündels
- Vorderseite der zweiten Seite im Bündel
5c. Anmerkungen
Die am linken Rand stehenden Zeichen vermitteln den Eindruck einer Aufzählung. Wenn diese Aufzählung numerisch ist, dann können sie einen Eindruck geben, wie kleine Zahlen im Schriftsystem des Voynich-Manuskriptes notiert werden. Leider würde es sich nur um die Zahlen von 1 bis 9 handeln. Diese lauten in EVA »* d q s o l k r s«
Das erste Zeichen wird zwar von allen Transkriptoren als »s« gelesen, aber ich kann nicht nachempfinden, auf welcher Grundlage sie so lesen. Tatsächlich handelt es sich um ein völlig einmaliges, sehr eckiges Symbol. Das letzte »s« entspricht mehr der ersten Hälte eines »sh«, der Knick ist deutlich ausgeführt. Wenigstens diese beiden Zeichen sollten auffallen, wenn sie auch an anderer Stelle im Manuskript vorkommen, und damit könnten sie einen wertvollen Hinweis geben, an welchen Stellen Zahlen notiert sind. Zu unserem Pech werden offenbar die Zahlen in gewöhnlichen Glyphen ausgedrückt, die sich ohne Kontext nicht von anderen Wörtern unterscheiden lassen.
5d. Fragen
- Tauchen die mutmaßlichen Zeichen für »1″ oder »9″ an irgendeiner Stelle im Manuskript auf?
5e. Spekulation
Wenn die Deutung »erste Hälfte von sh« für das neunte Zeichen richtig ist, dann gibt es eine Glyphe, die einem normalen »s« sehr ähnlich sieht, aber eben doch etwas anderes ist. »sh« ist dann offensichtlich eine Ligatur für eine sehr häufige Kombination mit dieser Glyphe. In bisherigen Transkriptionen wird diese Glyphe wohl immer als »s« erkannt worden sein, was unter Umständen zu großen Fehlern in den bisherigen Ergebnissen geführt hat.
6. Das unsichtbare Bad f81r
6a. Besonderheiten
Eine Seite der biologischen Sektion mit flatterhaftem rechten Rand, der den starken Eindruck erweckt, dass dort Raum für weitere Illustrationen gelassen wurde.
6b. Fakten
- Currier-Sprache: B, Handschrift 2
- Bestandteil des 13. Bündels
- Siebte Seite im Bündel
6c. Anmerkungen
Ein weiteres hervorragendes Beispiel dafür, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass die Illustrationen erst nachträglich in den Text eingefügt wurden. Wenn in dieser Reihenfolge vorgegangen wurde, überrascht es nicht, dass die Zeile im Manuskript eine klare Struktur hat, die sie zu einer Informationseinheit macht.
6d. Fragen
- Kann mit Bildbearbeitung ein Entwurf der beabsichtigten Zeichnung sichtbar gemacht werden?
7. Die Neun Rosetten oder Die Schatzkarte f86v5
Zu dieser einen Seite könnte man ein ganzes Buch schreiben, deshalb halte ich mich hier zurück. Aber es ist mit Sicherheit eine Seite, die unter den Seltsamen Seiten erwähnt werden muss.
8. Die Vier Quellen der Welt f86v3
8a. Besonderheiten
Vier in den Ecken des Blattes angeordnete seltsame Verrichtungen umgeben einen schwach sichtbaren Kreis in der Blattmitte. In diesen Kreis ist mit etwas unbeholfener Hand (vielleicht nachträglich) eine T-O-Karte der Erde eingezeichnet worden. Auf jeden Seitenrand befindet sich ein Absatz mit Text, darüber hinaus ist der obere Bereich über dem Kreis mit Text gefüllt.
In der Blattmitte ist eine unleserliche Kritzelei zu sehen. Diese scheint keinen Bezug zum Text zu haben, sondern eine nachträgliche Hinzufügung zu sein.
Hinter den beiden Gebilden auf der linken Seite verbergen sich Nymphen. Die untere Nymphe wirft einen undefinierbaren Gegenstand in Richtung auf die obere Nymphe. Die beiden Gebilde auf der rechten Seite sind mit Vögeln versehen, die ich für Enten halten würde. Die obere Ente fliegt auf, die untere schwimmt. Auf der Wasserfläche des unteren Gebildes stehen drei Röhrichthalme.
8b. Fakten
- Currier-Sprache: B, Handschrift 3
- Bestandteil des 14. Bündels
- Nur ein Bifolio im Ausfalt-Bündel
- Rückseite der ausfaltbaren Schatzkarte
In der unteren rechte Ecke befindet sich die Markierung des Bündels in mittelalterlichen arabischen Ziffern: »14us« — quatrodecimus, der Vierzehnte; die Endung »-us« ist ganz gewöhnlich durch eine hochgestellte »9« abgekürzt. Die Form dieser Ziffern lässt auf das 14. bis 16. Jahrhundert schließen (oder eben darauf, dass jemand den Eindruck dieser Zeit erwecken wollte).
8c. Anmerkungen
Durch die gepunkteten Verläufe aus dreien der vier Gebilde entsteht der Eindruck fließenden Wassers, die Enten und der Röhricht verstärken diesen Eindruck noch. Es scheint sich also um so etwas wie Quellen zu handeln, die auf die Erdscheibe in der Mitte zufließen. Die Quelle unten rechts fließt aber nicht, sondern ist ein ruhiges, durch den Röhricht vielleicht sogar als sumpfig angedeutetes Gewässer. Der Strom von oben links ist schwach und reicht nicht an die Welt heran, der geworfene Gegenstand der rechten unteren Nymphe könnte im Zusammenhang damit stehen.
8d. Fragen
- Kann das Gekritzel in der Blattmitte durch Bildbearbeitung erkennbar gemacht werden? Wenn ja: In welchem Alphabet ist es geschrieben? Ist es lesbar? Vielleicht verständlich? Hat es einen möglichen Bezug zum Inhalt dieser Seite?
- Kann durch Bildbearbeitung festgestellt werden, ob die T-O-Karte zum Entwurf des Autors gehörte. (Hat die Tinte die gleiche Farbe wie die Schrift? Handelt es sich um eine spätere Restauration und lassen sich noch Reste der alten Karte finden? War sie vielleicht sogar beschriftet?)
- Gibt es eine esoterische, religiöse oder volkstümliche Auffassung, dass die ganze Welt aus dem Wechselspiel vierer Quellen heraus bewässert wird.
8e. Spekulation
Esoterische Deutung der Jahreszeiten? Esoterische Deutung der Himmelsrichtungen? Esoterische Deutung der Weltalter? Gibt es irgendetwas (Mythos, Sage, Legende, Heilige Schrift), was zu dieser einzigartigen Darstellung (wirklich gut und überzeugend) passt? Ich akzeptiere wegen der Fremdartigkeit des gesamten Manuskriptes auch jeden nichteuropäischen Mythos, selbst amerikanische (indianische) sind mit willkommen. Die sehr fremd wirkende Symbolik dieser Darstellung kann den Ursprung des Manuskriptes unter Umständen leichter aufklären als alle Versuche, stark stilisierte Pflanzen zu identifizieren.
In meinen Augen ist dies die einzige kosmologische Darstellung, die gedeutet werden kann und eine Zuordnung zu einer Kultur (einer Sekte, einer esoterischen Tradition) ermöglicht. Wenn wir wissen, aus welchem Kreis dieses Manuskript kommt, haben wir eine Chance, die Sprache zutreffend zu erraten – und das ist unter Umständen die halbe »Übersetzung« oder »Entzifferung«.
(Aber wahrscheinlich wird sich auch diese Darstellung als geradezu außerirdisch erweisen und keine deutliche Ähnlichkeit zu irgend etwas bekanntem haben.)
Fußnoten
[1] Das ist natürlich ein Witz, aber die genaue Bedeutung der »biologischen« Sektion ist immer noch im Dunkel. Es wird ganz offenbar gebadet, aber die Strukturen, durch welche die grünen Wasser fließen, wirken gleichermaßen organisch wie außerweltlich.
[2] Sollte in Zukunft jemand mein Notizbuch finden und für wichtig halten, so wird es fast genau so viel Verwirrung auslösen wie das Voynich-Manuskript. Es besteht aus einem fröhlichen Nebeneinander hingehauchter Skizzen, Gedichte in einer strikt phonetischen Notation, Voynich-Glyphen und stark abgekürzten Texten. Manchmal wurde das Schreiben von einem einzigen, klaren Gedanken unterbrochen, und dann findet sich eine fast leere Seite, auf der nur in Versalien das Wort »METAREPRÄSENTATION« steht. Ich weiß meistens noch nach Jahren, was ich gemeint habe — aber es ist auch ein wirklich guter Code gegen allzu neugierige Augen…
 Man muss gar nicht so lange in das Manuskript schauen, um zu der Überzeugung zu kommen, dass die darin dargestellten »Pflanzen« wirklich surreal sind und eher einer Traumwelt entspringen. Schon die sechste Seite macht auf dem ersten Blick klar, dass es zumindest einige »Pflanzen« des Manuskriptes gar nicht in der Realität geben kann. Der Versuch, durch eine Identifikation der »Pflanzen« einen Ansatzpunkt für eine Entschlüsselung des Textes zu bekommen, ist zum Scheitern verurteilt.
Man muss gar nicht so lange in das Manuskript schauen, um zu der Überzeugung zu kommen, dass die darin dargestellten »Pflanzen« wirklich surreal sind und eher einer Traumwelt entspringen. Schon die sechste Seite macht auf dem ersten Blick klar, dass es zumindest einige »Pflanzen« des Manuskriptes gar nicht in der Realität geben kann. Der Versuch, durch eine Identifikation der »Pflanzen« einen Ansatzpunkt für eine Entschlüsselung des Textes zu bekommen, ist zum Scheitern verurteilt. Schon die Form der Blätter ist auffällig. Sie ist so auffällig, dass eine ähnliche Pflanze in der botanischen Wirklichkeit sofort identifiziert werden sollte.
Schon die Form der Blätter ist auffällig. Sie ist so auffällig, dass eine ähnliche Pflanze in der botanischen Wirklichkeit sofort identifiziert werden sollte.
 Völlig sicher scheint jedoch der surreale Charakter der Pflanzen zu sein, wenn man sich einige Blüten anschaut.
Völlig sicher scheint jedoch der surreale Charakter der Pflanzen zu sein, wenn man sich einige Blüten anschaut.
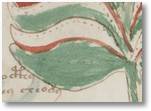 Zunächst sollte man sich nicht von der Farbgebung irritieren lassen. Die insgesamt sehr nachlässige Ausführung der Kolorierung steht im Gegensatz zu den zwar schnellen, aber doch alles in allem sorgfältigen Zeichnungen, die der Autor mit einer Feder anfertigte. Diese Farben wurden vermutlich erst nachträglich, vielleicht im Zuge einer Restauration, hinzugefügt, sie gehören eher nicht zum Entwurf des Autors. (Aber selbst das ist nicht völlig sicher.) Damit gehört auch eine typische und sehr verwirrende Eigenschaft vieler »Pflanzen« und auch dieses besonderen »Pflanze« des Manuskriptes nicht zum ursprünglichen Entwurf, und das sind die alternierenden Farben der Blätter.
Zunächst sollte man sich nicht von der Farbgebung irritieren lassen. Die insgesamt sehr nachlässige Ausführung der Kolorierung steht im Gegensatz zu den zwar schnellen, aber doch alles in allem sorgfältigen Zeichnungen, die der Autor mit einer Feder anfertigte. Diese Farben wurden vermutlich erst nachträglich, vielleicht im Zuge einer Restauration, hinzugefügt, sie gehören eher nicht zum Entwurf des Autors. (Aber selbst das ist nicht völlig sicher.) Damit gehört auch eine typische und sehr verwirrende Eigenschaft vieler »Pflanzen« und auch dieses besonderen »Pflanze« des Manuskriptes nicht zum ursprünglichen Entwurf, und das sind die alternierenden Farben der Blätter.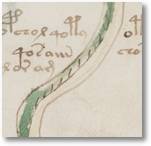 Was hingegen zum Entwurf gehören dürfte, dass sind die Punkte in Tintenfarbe auf den Unterseiten der stark überlappenden Blätter. Sie sind das einzige Merkmal, das auf diesen Blättern neben der Blattform angedeutet ist, sie scheinen also im Gegensatz zu einer Äderung oder Behaarung wichtig und »auffällig« zu sein. Beim Betrachten drängt sich der Gedanke an Sporen auf, die dargestellte »Pflanze« ist also ein Nacktsamer. Diese Interpretation deckt sich gut mit der Tatsache, dass diese »Pflanze« ohne eine Blüte dargestellt wurde, während die Mehrzahl der »Pflanzen« im Manuskript blühend gezeichnet sind. Auch der mit einer Schraffur auf dem Stängel angedeutete Schatten mit der klaren, explizit nachgezogenen Begrenzungslinie gehört wohl zur ursprünglichen Absicht des Zeichners, er soll vielleicht einen kantigen Stängel andeuten, wie man ihn ja bei vielen Pflanzen finden kann.
Was hingegen zum Entwurf gehören dürfte, dass sind die Punkte in Tintenfarbe auf den Unterseiten der stark überlappenden Blätter. Sie sind das einzige Merkmal, das auf diesen Blättern neben der Blattform angedeutet ist, sie scheinen also im Gegensatz zu einer Äderung oder Behaarung wichtig und »auffällig« zu sein. Beim Betrachten drängt sich der Gedanke an Sporen auf, die dargestellte »Pflanze« ist also ein Nacktsamer. Diese Interpretation deckt sich gut mit der Tatsache, dass diese »Pflanze« ohne eine Blüte dargestellt wurde, während die Mehrzahl der »Pflanzen« im Manuskript blühend gezeichnet sind. Auch der mit einer Schraffur auf dem Stängel angedeutete Schatten mit der klaren, explizit nachgezogenen Begrenzungslinie gehört wohl zur ursprünglichen Absicht des Zeichners, er soll vielleicht einen kantigen Stängel andeuten, wie man ihn ja bei vielen Pflanzen finden kann.
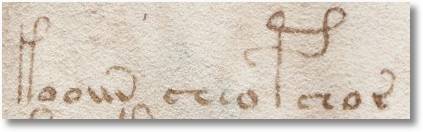
 Nun, diese Vokabelkenntnis ist nicht nur spekulativ und damit unsicher, sondern zudem auch kein so großer Fortschritt. Zumal wir uns bei dieser recht einfachen Angelegenheit bereits mitten im schwierigen Thema befinden, wie die im Manuskript erscheinende Glyphenfolge bei einer Transkription interpretiert werden soll – eine Frage, zu der es völlig verschiedene Meinungen gibt. Die Seerose führt uns also in den Glyphensumpf, in dem bislang alle Versuche untergegangen sind, die Mitteilungen eines unbekannten Schreibers aus dem Mittelalter zu lesen. Auch für umsichtige Wanderer, die nur etwas »kartographieren« wollen, ist das ein schwieriges Gelände.
Nun, diese Vokabelkenntnis ist nicht nur spekulativ und damit unsicher, sondern zudem auch kein so großer Fortschritt. Zumal wir uns bei dieser recht einfachen Angelegenheit bereits mitten im schwierigen Thema befinden, wie die im Manuskript erscheinende Glyphenfolge bei einer Transkription interpretiert werden soll – eine Frage, zu der es völlig verschiedene Meinungen gibt. Die Seerose führt uns also in den Glyphensumpf, in dem bislang alle Versuche untergegangen sind, die Mitteilungen eines unbekannten Schreibers aus dem Mittelalter zu lesen. Auch für umsichtige Wanderer, die nur etwas »kartographieren« wollen, ist das ein schwieriges Gelände. Das Thema habe ich ja bereits bei der Vorstellung des »Namens der Seerose« angeschnitten. Das Leerzeichen nach kooiin sieht relativ »sicher« aus, es ist ein größerer Abstand im Glyphenfluss. Aber schon die Frage, ob darauf cheo pchor oder cheo p chor oder auch cheopchor zu lesen ist, lässt sich nicht leicht entscheiden. Die p-Glyphe wirkt abgesetzt, sie hat auf beiden Seiten den gleichen Abstand. Dennoch lesen die meisten Transkriptoren hier cheo pchor.
Das Thema habe ich ja bereits bei der Vorstellung des »Namens der Seerose« angeschnitten. Das Leerzeichen nach kooiin sieht relativ »sicher« aus, es ist ein größerer Abstand im Glyphenfluss. Aber schon die Frage, ob darauf cheo pchor oder cheo p chor oder auch cheopchor zu lesen ist, lässt sich nicht leicht entscheiden. Die p-Glyphe wirkt abgesetzt, sie hat auf beiden Seiten den gleichen Abstand. Dennoch lesen die meisten Transkriptoren hier cheo pchor.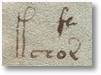 Manchmal scheint der Restaurator recht willkürlich Dinge nachgezogen und damit sichtbar gemacht zu haben, die mit Sicherheit nicht zum ursprünglichen Manuskript gehören – das erweckt kein besonderes Vertrauen in seine Arbeit am eigentlichen Text. Beim Anblick dieser Hinzufügungen wird am ehesten klar, dass hier jemand an der Erhaltung der Glyphenfolge gearbeitet hat, der noch weniger Verständnis als ich vom Aufbau des Schriftsystems hatte und der deshalb gewiss nichts lesen konnte.
Manchmal scheint der Restaurator recht willkürlich Dinge nachgezogen und damit sichtbar gemacht zu haben, die mit Sicherheit nicht zum ursprünglichen Manuskript gehören – das erweckt kein besonderes Vertrauen in seine Arbeit am eigentlichen Text. Beim Anblick dieser Hinzufügungen wird am ehesten klar, dass hier jemand an der Erhaltung der Glyphenfolge gearbeitet hat, der noch weniger Verständnis als ich vom Aufbau des Schriftsystems hatte und der deshalb gewiss nichts lesen konnte.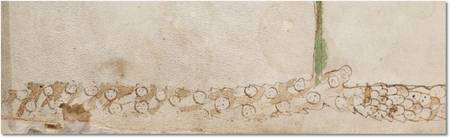

 So auch das Wort kydainy, dieses völlig »unverdächtig« aussehende erste Wort der Seite f2r. Die beschriebene Transformation verwandelt dieses »Wort« in »kydaino«, und dieses Muster kommt im gesamten pflanzenkundlichen Teil des Voynich-Manuskriptes nicht noch einmal vor – trotz einer Transformation, die ähnlich gebaute »Wörter« aufgefunden hätte. Das ist – alles in allem – ein eher unerwartetes und verwirrendes Ergebnis einer recht einfachen Untersuchung, das die These stützt, dass es sich beim »Text« des Manuskriptes um eine direkt notierte Sprache handeln könnte.
So auch das Wort kydainy, dieses völlig »unverdächtig« aussehende erste Wort der Seite f2r. Die beschriebene Transformation verwandelt dieses »Wort« in »kydaino«, und dieses Muster kommt im gesamten pflanzenkundlichen Teil des Voynich-Manuskriptes nicht noch einmal vor – trotz einer Transformation, die ähnlich gebaute »Wörter« aufgefunden hätte. Das ist – alles in allem – ein eher unerwartetes und verwirrendes Ergebnis einer recht einfachen Untersuchung, das die These stützt, dass es sich beim »Text« des Manuskriptes um eine direkt notierte Sprache handeln könnte. Interessanterweise enthält die Seite f2r zwei Absätze, und der zweite Absatz beginnt mit der sehr ähnlichen Glyphenfolge kydain – da fehlt nur die y-Endung. Auch dieses »Wort« ist im gesamten Manuskript eindeutig, so dass der Verdacht sehr nahe liegt, dass gewisse Endungen eine »grammatikalische« Erscheinung sind. Aber das ist ein völlig anderes Thema, das hier einmal ausführlich gewürdigt werden wird.
Interessanterweise enthält die Seite f2r zwei Absätze, und der zweite Absatz beginnt mit der sehr ähnlichen Glyphenfolge kydain – da fehlt nur die y-Endung. Auch dieses »Wort« ist im gesamten Manuskript eindeutig, so dass der Verdacht sehr nahe liegt, dass gewisse Endungen eine »grammatikalische« Erscheinung sind. Aber das ist ein völlig anderes Thema, das hier einmal ausführlich gewürdigt werden wird. Dass man einen mutmaßlichen Namen der Pflanze angeben kann, hilft leider nicht beim Lesen des Manuskriptes. Denn diese »Pflanze« ist nicht identifizierbar. Dies gilt für alle Pflanzen der Manuskriptes, so dass die von Jorge Stolfi gefundene Eigenschaft nicht beim Lesen des Textes hilfreich ist.
Dass man einen mutmaßlichen Namen der Pflanze angeben kann, hilft leider nicht beim Lesen des Manuskriptes. Denn diese »Pflanze« ist nicht identifizierbar. Dies gilt für alle Pflanzen der Manuskriptes, so dass die von Jorge Stolfi gefundene Eigenschaft nicht beim Lesen des Textes hilfreich ist. Sehr eigentümlich ist die gezeichnete Form der Wurzel.
Sehr eigentümlich ist die gezeichnete Form der Wurzel.
 Auf dieser Seite f1v wirkt die Pflanze auf dem ersten Blick völlig vertraut. Jeder, der schon einmal eine hübsch und durchaus lecker anzuschauende Tollkirsche (atropa belladonna) gesehen hat, meint hier die stark stilisierte Zeichnung einer solchen zu erkennen. Es sind vor allem der Blattstand, die ganzrandige, ungeteilte Form der Laubblätter und die Form der Frucht, die diesen Eindruck so unwiderstehlich machen. Auch die Verzweigung gibt die Wuchsform einer etwa 1,50 Meter hohen Pflanze vereinfacht, aber doch zutreffend wieder. Da die Frucht zu alledem noch passend mit der normalen Tintenfarbe ausgefüllt ist und deshalb im Kontext der Kolorierung schwarz erscheint, muss man geradezu an eine
Auf dieser Seite f1v wirkt die Pflanze auf dem ersten Blick völlig vertraut. Jeder, der schon einmal eine hübsch und durchaus lecker anzuschauende Tollkirsche (atropa belladonna) gesehen hat, meint hier die stark stilisierte Zeichnung einer solchen zu erkennen. Es sind vor allem der Blattstand, die ganzrandige, ungeteilte Form der Laubblätter und die Form der Frucht, die diesen Eindruck so unwiderstehlich machen. Auch die Verzweigung gibt die Wuchsform einer etwa 1,50 Meter hohen Pflanze vereinfacht, aber doch zutreffend wieder. Da die Frucht zu alledem noch passend mit der normalen Tintenfarbe ausgefüllt ist und deshalb im Kontext der Kolorierung schwarz erscheint, muss man geradezu an eine  In gewisser Weise erfüllt diese Deutung ja auch die ersten Erwartungen an das Manuskript. In einem aufwändig verschlüsselten Buch würden ja gewiss keine Zierpflanzen behandelt, die jeder Mensch aus seiner Alltagserfahrung kennt. Es sind eher solche Pflanzen zu erwarten, die ein gesellschaftlich und religiös verpöntes oder gar verbotenes spirituelles Erleben zur Folge haben. Es handelt sich bei dem in allen Pflanzenteilen der Tollkirsche enthaltenen Hyoscyamin um ein ausgesprochen starkes Halluzinogen, das bedrückende, angstvolle, finstere und melancholische Trips auslöst. Das ist auch der tiefere Grund dafür, dass diese Pflanze nicht in ähnlicher Weise gesetzlich verboten ist wie der bei vielen Menschen so beliebte indische Hanf. Der von einer Tollkirsche ausgelöste Trip ist eine Erfahrung, die ein Mensch in aller Regel nicht wiederholen möchte. Dass dieses Mittel nicht als »Partydroge« für die heutige Zeit geeignet ist, sagt allerdings nichts über die Eignung der gleichen Droge für gewisse mystische oder spirituelle Erfahrungen in religiösen Gemeinschaften fernab des gesellschaftlichen und religiösen Mainstreams.
In gewisser Weise erfüllt diese Deutung ja auch die ersten Erwartungen an das Manuskript. In einem aufwändig verschlüsselten Buch würden ja gewiss keine Zierpflanzen behandelt, die jeder Mensch aus seiner Alltagserfahrung kennt. Es sind eher solche Pflanzen zu erwarten, die ein gesellschaftlich und religiös verpöntes oder gar verbotenes spirituelles Erleben zur Folge haben. Es handelt sich bei dem in allen Pflanzenteilen der Tollkirsche enthaltenen Hyoscyamin um ein ausgesprochen starkes Halluzinogen, das bedrückende, angstvolle, finstere und melancholische Trips auslöst. Das ist auch der tiefere Grund dafür, dass diese Pflanze nicht in ähnlicher Weise gesetzlich verboten ist wie der bei vielen Menschen so beliebte indische Hanf. Der von einer Tollkirsche ausgelöste Trip ist eine Erfahrung, die ein Mensch in aller Regel nicht wiederholen möchte. Dass dieses Mittel nicht als »Partydroge« für die heutige Zeit geeignet ist, sagt allerdings nichts über die Eignung der gleichen Droge für gewisse mystische oder spirituelle Erfahrungen in religiösen Gemeinschaften fernab des gesellschaftlichen und religiösen Mainstreams.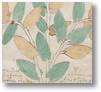 Zunächst eine Besonderheit des Manuskriptes, die sich noch auf vielen anderen Seiten des »pflanzenkundlichen« Teiles und ebenso im »pharmazeutischen« Teil zeigen wird. Die »Pflanzen« tragen häufig zwei verschiedene Arten von Blättern. Diese verschiedenen Blätter unterscheiden sich (meistens) nicht in ihrer Form, sondern nur in ihrer Farbe. Pflanzen mit zwei verschiedenen Arten von Blättern sind in der Natur durchaus keine Seltenheit, an jeder Linde kann man unterschiedliche Blätter sehen, die sich in Größe und Dicke klar unterscheiden; nämlich solche, die direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind und solche, die im Schatten der äußeren Blätter liegen. Deutlich unterscheidbare Blattfärbungen sind hingegen in Europa ein seltener Anblick; und dass irgendeiner Pflanze Blätter in zwei klar unterscheidbaren Farben in alterniernder Folge am Stängel wüchsen, wäre eine der irdischen Botanik gänzlich unbekannte Gestaltung. Dennoch ist das Manuskript voll mit solchen »Pflanzen«.
Zunächst eine Besonderheit des Manuskriptes, die sich noch auf vielen anderen Seiten des »pflanzenkundlichen« Teiles und ebenso im »pharmazeutischen« Teil zeigen wird. Die »Pflanzen« tragen häufig zwei verschiedene Arten von Blättern. Diese verschiedenen Blätter unterscheiden sich (meistens) nicht in ihrer Form, sondern nur in ihrer Farbe. Pflanzen mit zwei verschiedenen Arten von Blättern sind in der Natur durchaus keine Seltenheit, an jeder Linde kann man unterschiedliche Blätter sehen, die sich in Größe und Dicke klar unterscheiden; nämlich solche, die direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind und solche, die im Schatten der äußeren Blätter liegen. Deutlich unterscheidbare Blattfärbungen sind hingegen in Europa ein seltener Anblick; und dass irgendeiner Pflanze Blätter in zwei klar unterscheidbaren Farben in alterniernder Folge am Stängel wüchsen, wäre eine der irdischen Botanik gänzlich unbekannte Gestaltung. Dennoch ist das Manuskript voll mit solchen »Pflanzen«. Was ebenfalls verwundert, ist die Tatsache, dass der Stängel oft nicht farbig ausgemalt ist, obwohl dem Autor (oder seinem Mitarbeiter, der die Kolorierung durchgeführt hat) eine grüne Farbe zur Verfügung stand. So entsteht der Eindruck von weißen Pflanzenstängeln, die in einem eigentümlichen Kontrast zur Farbigkeit der Blätter und Blüten stehen. An solchen, wohl absichtsvoll gezeichneten Details wird klar, dass es sich hier wohl nicht um die Darstellung irdischer Pflanzen handeln soll, die Ähnlichkeiten zu manchem vertrauten Anblick sollten also nicht überbewertet werden.
Was ebenfalls verwundert, ist die Tatsache, dass der Stängel oft nicht farbig ausgemalt ist, obwohl dem Autor (oder seinem Mitarbeiter, der die Kolorierung durchgeführt hat) eine grüne Farbe zur Verfügung stand. So entsteht der Eindruck von weißen Pflanzenstängeln, die in einem eigentümlichen Kontrast zur Farbigkeit der Blätter und Blüten stehen. An solchen, wohl absichtsvoll gezeichneten Details wird klar, dass es sich hier wohl nicht um die Darstellung irdischer Pflanzen handeln soll, die Ähnlichkeiten zu manchem vertrauten Anblick sollten also nicht überbewertet werden.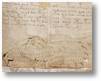 Dazu passt es, dass viele Gestaltmerkmale eine nur oberflächliche Ähnlichkeit mit wirklichen Pflanzen haben und wirken, als seien sie wirr kombiniert. Dies gilt auch für die scheinbare »Schwarze Tollkirsche« auf Seite f1v. Diese »Pflanze« ist vollständig gezeichnet, auch das Wurzelsystem kann also betrachtet werden. Die Wurzel hat aber eine sehr ungewöhnliche Form. Sie hat keine Verzweigungen, sondern bildet wenige grobe und unförmige Ballen, die als behaarte Objekte gezeichnet wurden. Allein diese deutlich skizzierte, sehr regelmäßige Behaarung dieser Wurzel macht es unmöglich, die klumpige Form als anhängende Erdballen zu deuten. Nein, in der Darstellung dieser »Pflanze« sind dicke, fleischige Wurzeln beabsichtigt. Auf diese gar nicht dazu passen wollende Wurzel wurde ein oberirdisch »wachsender« Teil aufgesetzt, der große Ähnlichkeiten zu einer Tollkirsche aufweist. Auf ähnliche Weise scheinen viele »Pflanzen« durch eine Kombination von Elementen entstanden zu sein, über deren Bedeutung wir noch keine Klarheit haben.
Dazu passt es, dass viele Gestaltmerkmale eine nur oberflächliche Ähnlichkeit mit wirklichen Pflanzen haben und wirken, als seien sie wirr kombiniert. Dies gilt auch für die scheinbare »Schwarze Tollkirsche« auf Seite f1v. Diese »Pflanze« ist vollständig gezeichnet, auch das Wurzelsystem kann also betrachtet werden. Die Wurzel hat aber eine sehr ungewöhnliche Form. Sie hat keine Verzweigungen, sondern bildet wenige grobe und unförmige Ballen, die als behaarte Objekte gezeichnet wurden. Allein diese deutlich skizzierte, sehr regelmäßige Behaarung dieser Wurzel macht es unmöglich, die klumpige Form als anhängende Erdballen zu deuten. Nein, in der Darstellung dieser »Pflanze« sind dicke, fleischige Wurzeln beabsichtigt. Auf diese gar nicht dazu passen wollende Wurzel wurde ein oberirdisch »wachsender« Teil aufgesetzt, der große Ähnlichkeiten zu einer Tollkirsche aufweist. Auf ähnliche Weise scheinen viele »Pflanzen« durch eine Kombination von Elementen entstanden zu sein, über deren Bedeutung wir noch keine Klarheit haben. Dieser Bildausschnitt ist nicht etwa eine ungelenkige Zeichnung eines heraldischen Adlers, obwohl der Gedanke beim Anblick wirklich nahe liegt. Die Zeichnung macht nicht den Eindruck, dass sie den Bestandteil einer Pflanze darstellt.
Dieser Bildausschnitt ist nicht etwa eine ungelenkige Zeichnung eines heraldischen Adlers, obwohl der Gedanke beim Anblick wirklich nahe liegt. Die Zeichnung macht nicht den Eindruck, dass sie den Bestandteil einer Pflanze darstellt.